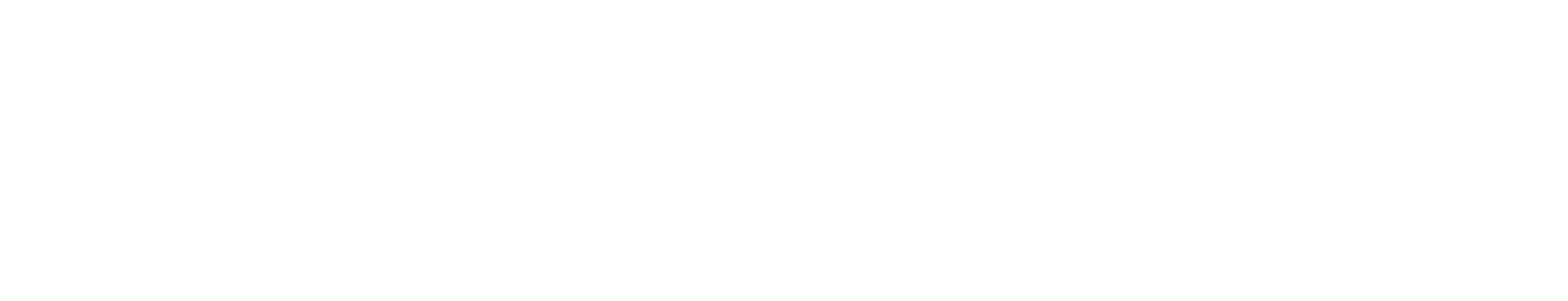Miriam Rürup
VORSITZENDE
WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT
Interview und Text:
Grete Götze, Frankfurt
Juni 2021
„Ich finde es wichtig, dass man jüdische Geschichte nicht gesondert betrachtet, das wäre ja wieder eine Ausgrenzung von Juden innerhalb der Wissenschaft, sondern integriert in die Gesamtgeschichte.“
EINE FÜR ALLE
Wären ihre Eltern damals, in den Siebziger Jahren, an einen anderen Kinderarzt geraten, hätte Miriam Rürup wahrscheinlich schon als Kind hebräisch gelernt – schließlich ist ihre Mutter Israelin. Der Karlsruher Arzt aber sagte, Zweisprachigkeit würde Kinder verwirren, weil sie dann zwischen zwei Identitäten lebten und keine Sprache richtig lernten. So wurde zu Hause deutsch gesprochen, und Rürup musste die Sprache später selbst in Israel lernen. Ihre Mutter war von dort zum Architekturstudium nach Deutschland gekommen, ins Geburtsland von Bauhaus, na klar. Dort lernte sie ihren Vater kennen, damals Lehramts-Student für Deutsch, Französisch und Politik.
Aus heutiger Sicht erscheint es also nicht wie ein Zufall, dass Rürup Historikerin ist und sich mit jüdischer Geschichte beschäftigt. Kürzlich wurde die 48-Jährige zur Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam berufen. Trotzdem sagt Rürup, ihr Interesse für das Thema sei eher zufällig entstanden. Damals studierte sie in Göttingen, wo Studentenverbindungen zum städtischen Alltag gehörten. „Ich fand, dass so etwas Männerbündisches wie eine Studentenverbindung eigentlich nicht mit einer modernen Gesellschaft vereinbar ist, deshalb hat es mich interessiert.“ Durch einen Zeitungsartikel stolperte sie dann darüber, dass es früher auch jüdische Studentenverbindungen gab. In ihrer Dissertation verglich Rürup dann zionistische mit deutsch-vaterländischen jüdischen Studentenverbindungen. Sie hätten sich gegründet, weil sie Teil der studentischen Gesellschaft sein wollten, erklärt Rürup. Und so ist auch ihr eigener Zugang zu Geschichte ein umfassender: „Ich finde es wichtig, dass man jüdische Geschichte nicht gesondert betrachtet, das wäre ja wieder eine Ausgrenzung von Juden innerhalb der Wissenschaft, sondern integriert in die Gesamtgeschichte.“
Man merkt, dass Rürup eine Sensibilität für Marginalisierte hat und von Ungleichbehandlung nicht viel hält. Wenn sie gendert, etwa von „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“ spricht, ist es auch ein Appell dafür, dass Frauen in allen Bereichen des Lebens eine aktive Rolle spielen können. „Aber leider sind unsere gesellschaftlichen Strukturen immer noch sehr patriarchal geprägt. Im Grundgesetz steht zwar, dass Frauen und Männer gleich sind, aber man darf nicht vergessen, dass sie zum Beispiel selbst im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zunächst kein Recht auf eine eigenständige Staatsangehörigkeit hatten, sondern darin ihrem Vater oder Ehemann folgen mussten.“ Selbst wenn heute alle vor dem Gesetz gleich seien, zeige sich das in der Praxis noch lange nicht überall. In Vorständen und überhaupt in der Wirtschaft sei der Anteil von Frauen immer noch geringer, Frauen verdienten immer noch weniger. „Da ist noch viel zu tun“, sagt Rürup freundlich-bestimmt.
Sich einzubringen und politisch zu äußern kennt Rürup aus ihrem Elternhaus – ein säkuläres, in dem sich das Jüdischsein eher über das Interesse für Israel und seine Politik zeigte. Zwar feierte man Pessach, ein jüdisches Hochfest, das an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei erinnert. Weihnachten aber wurde zum Beispiel als „Weihnukka“ an einer großen Tafel mit Exil-Libanesen, Palästinensern und anderen gefeiert, die sonst vielleicht alleine gewesen wären. Die Familie verkehrte viel in linken, halbisraelischen Kreisen, wie etwa im „Haltener Kreis“, zu deren Mitgliedern auch Teile der Frankfurter Jüdischen Gruppe zählten, rund um die von Micha Brumlik, Cilly Kugelmann und Dan Diner herausgegebene Zeitschrift Babylon. Hitzige Diskussionen um Israel und Palästina nach dem Sechstagekrieg 1967 gehörten zum Alltag. Die Sorge, dass Israel als Besatzungsmacht einen Teil seiner Grundsätze verlieren könnte, war groß.
In der orthodox-geprägten, jüdischen Gemeinde in Karlsruhe dagegen fühlte sich Rürup nie richtig zu Hause. Dass es auch ein liberales, ein Reform-Judentum gab, erfuhr sie erst später richtig als Aupairmädchen in der Familie von Naamah Kelman-Ezrachi, der ersten Frau, die als Rabbinerin in Israel ausgebildet und ordiniert wurde. Den Ort zu wechseln ist für Rürup selbstverständlich. Als Postdoc verschlug es sie nach Washington ans Deutsche Historische Institut, bevor sie die Leitung des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg übernahm.
Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, England, Israel und Amerika miteinander zu vernetzen, die sich an den Standorten der drei Leo Baeck Institute mit deutsch-jüdischer Geschichte beschäftigen, das ist eine ihrer Aufgaben als Vorsitzende der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts. Neben Forschung und Vernetzung geht es auch um Transfer. Um die Frage, wie man deutsch-jüdische Geschichte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. So haben Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zum Beispiel einen Ratgeber für Lehrerinnen und Lehrer herausgegeben, der reflektiert, wie man deutsch-jüdische Geschichte im Schulunterricht vermitteln kann. Es gibt auch die Perspektiven deutsch-jüdischer Geschichte, eine kleine Buchreihe für interessierte Laien oder Studuierende, die auf jeweils 150 bis 200 Seiten eine Einführung in die jüdische Geschichte mit Blick auf Religion, Geschlecht, Migration, Alltag und Gesellschaft oder Rechtsfragen bekommen möchten.
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft treffen sich zum Beispiel alle zwei Jahre im Rahmen des Historiker-Tages oder in einem Netzwerk von Postdocs und entwickeln gemeinsam Projekte. Ihr neuestes Vorhaben ist ein Projekt zur deutsch-jüdischen „Diaspora“,also das Leben von jüdischen Minderheiten in den Ländern des Exils. In einem Sammelband und auf einer Onlineseite soll es um aus Deutschland emigrierte Jüdinnen und Juden gehen, für die Deutschland auch eine Heimat geblieben ist, in die sie sich selbst nach Jahren im Exil zurücksehnen. Im New Yorker Stadtteil „Washington Heights“ etwa, das heute eher von Puertorikaner*innen geprägt ist, habe es in den Dreißiger und Vierziger Jahren eine starke deutsch-jüdische Diaspora gegeben, erzählt Rürup. Die deutschen Jüdinnen und Juden seien dort „bei undzers“ genannt worden, weil sie ständig gesagt hätten: „Bei uns macht man das so.“ Auch architektonisch gebe es deutsche Spuren im Ausland. Beispielsweise entspreche der Jerusalemer Stadtteil Rehavia dem Muster der deutschen Gartenstadt, die vielen Menschen grünes Leben in der Großstadt ermöglichen wollte.
In einer vielfältigen Gesellschaft zu leben, in der sich unterschiedliche Kulturen befruchten, jeder und jede etwas Eigenes einbringt, das entspricht auch Rürups persönlicher Vorstellung von einer funktionierenden Gesellschaft. Allerdings gebe es immer noch eine tief sitzende Ausländerfeindlichkeit, die zeige, dass Deutschland sich immer noch nicht selbstverständlich als Einwanderungsland begreife. Sie sei besorgt, wenn die Rede vom jüdisch-christlichen Abendland sei. „Da wird doch eine völlige Fantasiefigur heraufbeschworen. Das dient doch seit einigen Jahren vor allem der Abwehr alles Muslimischen. Ansonsten ist das jüdisch-christliche Abendland eher eines, in dem Christen Juden verfolgten und rechtlich außen vor hielten.“
Die Historikerin kritisiert, wie gerne der muslimische Antisemitismus hervorgehoben werde. „Weil man häufig den Eindruck hat, das ist fast schon so eine Art Ablenkungsmanöver vom eigenen, in der christlich geprägten deutschen Gesellschaft verwurzelten Antisemitismus“. Immerhin sei er seit dem Zweiten Weltkrieg zurückgegangen, aber eben immer noch da und werde heute im Zuge der „Corona-Proteste“ auch wieder erschreckend lauter.
Für ein liberales, säkulares Jüdischsein, das linke Politik auch in Israel unterstütze, gebe es in Deutschland bislang kein großes Milieu. Entstehe das denn? „Ich hoffe es zumindest“, sagt Rürup und lacht.
Aus heutiger Sicht erscheint es also nicht wie ein Zufall, dass Rürup Historikerin ist und sich mit jüdischer Geschichte beschäftigt. Kürzlich wurde die 48-Jährige zur Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam berufen. Trotzdem sagt Rürup, ihr Interesse für das Thema sei eher zufällig entstanden. Damals studierte sie in Göttingen, wo Studentenverbindungen zum städtischen Alltag gehörten. „Ich fand, dass so etwas Männerbündisches wie eine Studentenverbindung eigentlich nicht mit einer modernen Gesellschaft vereinbar ist, deshalb hat es mich interessiert.“ Durch einen Zeitungsartikel stolperte sie dann darüber, dass es früher auch jüdische Studentenverbindungen gab. In ihrer Dissertation verglich Rürup dann zionistische mit deutsch-vaterländischen jüdischen Studentenverbindungen. Sie hätten sich gegründet, weil sie Teil der studentischen Gesellschaft sein wollten, erklärt Rürup. Und so ist auch ihr eigener Zugang zu Geschichte ein umfassender: „Ich finde es wichtig, dass man jüdische Geschichte nicht gesondert betrachtet, das wäre ja wieder eine Ausgrenzung von Juden innerhalb der Wissenschaft, sondern integriert in die Gesamtgeschichte.“
Man merkt, dass Rürup eine Sensibilität für Marginalisierte hat und von Ungleichbehandlung nicht viel hält. Wenn sie gendert, etwa von „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern“ spricht, ist es auch ein Appell dafür, dass Frauen in allen Bereichen des Lebens eine aktive Rolle spielen können. „Aber leider sind unsere gesellschaftlichen Strukturen immer noch sehr patriarchal geprägt. Im Grundgesetz steht zwar, dass Frauen und Männer gleich sind, aber man darf nicht vergessen, dass sie zum Beispiel selbst im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zunächst kein Recht auf eine eigenständige Staatsangehörigkeit hatten, sondern darin ihrem Vater oder Ehemann folgen mussten.“ Selbst wenn heute alle vor dem Gesetz gleich seien, zeige sich das in der Praxis noch lange nicht überall. In Vorständen und überhaupt in der Wirtschaft sei der Anteil von Frauen immer noch geringer, Frauen verdienten immer noch weniger. „Da ist noch viel zu tun“, sagt Rürup freundlich-bestimmt.
Sich einzubringen und politisch zu äußern kennt Rürup aus ihrem Elternhaus – ein säkuläres, in dem sich das Jüdischsein eher über das Interesse für Israel und seine Politik zeigte. Zwar feierte man Pessach, ein jüdisches Hochfest, das an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei erinnert. Weihnachten aber wurde zum Beispiel als „Weihnukka“ an einer großen Tafel mit Exil-Libanesen, Palästinensern und anderen gefeiert, die sonst vielleicht alleine gewesen wären. Die Familie verkehrte viel in linken, halbisraelischen Kreisen, wie etwa im „Haltener Kreis“, zu deren Mitgliedern auch Teile der Frankfurter Jüdischen Gruppe zählten, rund um die von Micha Brumlik, Cilly Kugelmann und Dan Diner herausgegebene Zeitschrift Babylon. Hitzige Diskussionen um Israel und Palästina nach dem Sechstagekrieg 1967 gehörten zum Alltag. Die Sorge, dass Israel als Besatzungsmacht einen Teil seiner Grundsätze verlieren könnte, war groß.
In der orthodox-geprägten, jüdischen Gemeinde in Karlsruhe dagegen fühlte sich Rürup nie richtig zu Hause. Dass es auch ein liberales, ein Reform-Judentum gab, erfuhr sie erst später richtig als Aupairmädchen in der Familie von Naamah Kelman-Ezrachi, der ersten Frau, die als Rabbinerin in Israel ausgebildet und ordiniert wurde. Den Ort zu wechseln ist für Rürup selbstverständlich. Als Postdoc verschlug es sie nach Washington ans Deutsche Historische Institut, bevor sie die Leitung des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg übernahm.
Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland, England, Israel und Amerika miteinander zu vernetzen, die sich an den Standorten der drei Leo Baeck Institute mit deutsch-jüdischer Geschichte beschäftigen, das ist eine ihrer Aufgaben als Vorsitzende der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts. Neben Forschung und Vernetzung geht es auch um Transfer. Um die Frage, wie man deutsch-jüdische Geschichte einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. So haben Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft zum Beispiel einen Ratgeber für Lehrerinnen und Lehrer herausgegeben, der reflektiert, wie man deutsch-jüdische Geschichte im Schulunterricht vermitteln kann. Es gibt auch die Perspektiven deutsch-jüdischer Geschichte, eine kleine Buchreihe für interessierte Laien oder Studuierende, die auf jeweils 150 bis 200 Seiten eine Einführung in die jüdische Geschichte mit Blick auf Religion, Geschlecht, Migration, Alltag und Gesellschaft oder Rechtsfragen bekommen möchten.
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft treffen sich zum Beispiel alle zwei Jahre im Rahmen des Historiker-Tages oder in einem Netzwerk von Postdocs und entwickeln gemeinsam Projekte. Ihr neuestes Vorhaben ist ein Projekt zur deutsch-jüdischen „Diaspora“,also das Leben von jüdischen Minderheiten in den Ländern des Exils. In einem Sammelband und auf einer Onlineseite soll es um aus Deutschland emigrierte Jüdinnen und Juden gehen, für die Deutschland auch eine Heimat geblieben ist, in die sie sich selbst nach Jahren im Exil zurücksehnen. Im New Yorker Stadtteil „Washington Heights“ etwa, das heute eher von Puertorikaner*innen geprägt ist, habe es in den Dreißiger und Vierziger Jahren eine starke deutsch-jüdische Diaspora gegeben, erzählt Rürup. Die deutschen Jüdinnen und Juden seien dort „bei undzers“ genannt worden, weil sie ständig gesagt hätten: „Bei uns macht man das so.“ Auch architektonisch gebe es deutsche Spuren im Ausland. Beispielsweise entspreche der Jerusalemer Stadtteil Rehavia dem Muster der deutschen Gartenstadt, die vielen Menschen grünes Leben in der Großstadt ermöglichen wollte.
In einer vielfältigen Gesellschaft zu leben, in der sich unterschiedliche Kulturen befruchten, jeder und jede etwas Eigenes einbringt, das entspricht auch Rürups persönlicher Vorstellung von einer funktionierenden Gesellschaft. Allerdings gebe es immer noch eine tief sitzende Ausländerfeindlichkeit, die zeige, dass Deutschland sich immer noch nicht selbstverständlich als Einwanderungsland begreife. Sie sei besorgt, wenn die Rede vom jüdisch-christlichen Abendland sei. „Da wird doch eine völlige Fantasiefigur heraufbeschworen. Das dient doch seit einigen Jahren vor allem der Abwehr alles Muslimischen. Ansonsten ist das jüdisch-christliche Abendland eher eines, in dem Christen Juden verfolgten und rechtlich außen vor hielten.“
Die Historikerin kritisiert, wie gerne der muslimische Antisemitismus hervorgehoben werde. „Weil man häufig den Eindruck hat, das ist fast schon so eine Art Ablenkungsmanöver vom eigenen, in der christlich geprägten deutschen Gesellschaft verwurzelten Antisemitismus“. Immerhin sei er seit dem Zweiten Weltkrieg zurückgegangen, aber eben immer noch da und werde heute im Zuge der „Corona-Proteste“ auch wieder erschreckend lauter.
Für ein liberales, säkulares Jüdischsein, das linke Politik auch in Israel unterstütze, gebe es in Deutschland bislang kein großes Milieu. Entstehe das denn? „Ich hoffe es zumindest“, sagt Rürup und lacht.