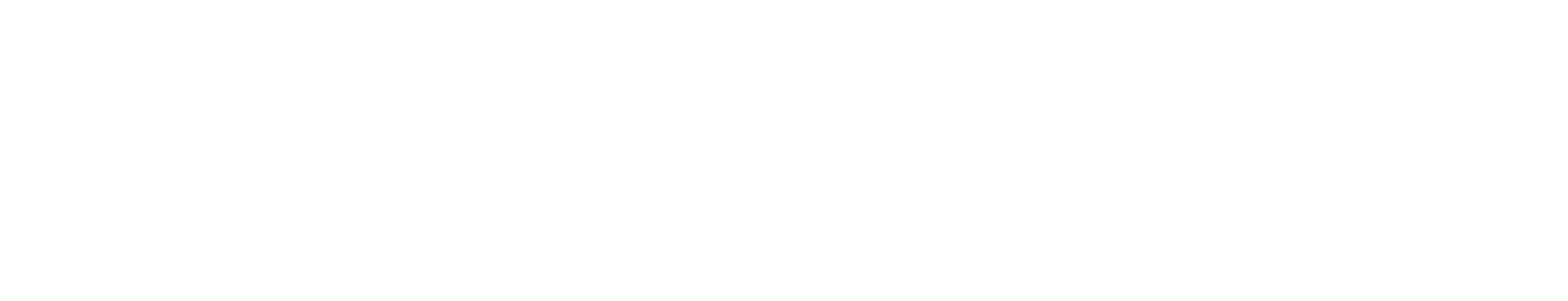Galili Shahar
PRÄSIDENT
LBI JERUSALEM
Grete Götze, Frankfurt
„Unsere Aufgabe ist es, die Geschichte immer wieder zu lesen, die politische und kulturelle Vergangenheit neu zu interpretieren.“
FÜR FRÖHLICH-WILDE
WISSENSCHAFT
Als Kind dachte Galili Shahar, in Deutschland spreche man persisch. Seine Eltern waren in den Fünfziger Jahren aus Iran nach Tel Aviv emigriert, seine Tante war nach Hamburg gegangen. Wenn sie zu Besuch kam, wurde ein wilder Mischmasch aus persisch, deutsch und hebräisch gesprochen. „Das war ein Hinweis auf die Zukunft“, sagt der 51-Jährige rückblickend. Literatur und Bildung waren schon immer Teil seines Lebens, „aber eher im östlichen Sinne des Wortes“. Shahars Vater, Schmuckhändler aus Schiras, kannte fast den ganzen Kanon der klassischen persischen Dichtung, seine Mutter las lieber Romane. Der Junge erlebte Literatur als etwas Lebendiges, wozu auch Musik und geselliges Zusammensein gehörte.
Seine akademische Laufbahn nennt der Komparatistik-Professor „ein bisschen episodisch“. Das Interesse für Deutschland, gleichzeitig das Land der Nazis und der großen Denker, war da. Erst studierte Shahar Philosophie und Geschichte, wollte Immanuel Kant und die Philosophie der Aufklärung verstehen, dann wurde in Berlin Germanistik und Literaturwissenschaft daraus.
„Als die Mauer fiel, war ich in Israel noch als Soldat bei der Marine. Aber dieses Ereignis war für mich ein Zeichen von Freiheit und Selbstbestimmung der Nation. Da wollte ich unbedingt dabei sein“, erzählt Shahar im Zoom-Interview lebhaft gestikulierend, wie stets mit Baskenmütze und Nickelbrille ausgestattet. Er habe als junger Mann ein glückliches, naives Bild von Berlin gehabt. Migrant*innen aus Syrien, der Türkei und Israel hätten friedlich miteinander gelebt. Die Verdichtung deutscher und jüdischer Geschichte sei spürbar gewesen. Shahar saugte die Kultur ein, war fast jeden Abend im Theater, schaute sich Thomas Bernhards Stücke in der Regie von Claus Peymann an. An der freien Universität entstand seine Dissertation über das Theater der Aufklärung in Deutschland um Achtzehnhundert.
Zurück in Israel kam Shahar erstmals mit dem Jerusalemer Leo Baeck Institut in Berührung, dessen Präsident er heute ist. Anlässlich seines 50. Geburtstags gab es eine Veranstaltung mit dem Thema „deutsch-jüdische Symbiose“. Der junge Lektor war beeindruckt von der Gelehrsamkeit deutsch-israelischer Historiker wie Michael Brenner und Moshe Zimmermann. Shahar erinnert sich, dass er damals einen Vortrag gehalten habe, der beim Publikum kontrovers diskutiert worden sei. „Ich war beeindruckt von der Spannung, die dadurch entstand. Es war auch ein Zeichen für meine Beziehung zu dem Institut. Ich bin ein bisschen fremd, ein bisschen zu schnell dafür, aber es ist ein Ort, wo ich meine Meinung gerne zur Debatte stelle“, sagt Shahar. In Tel Aviv, wo er seit 2010 Professor für vergleichende Literaturwissenschaft ist und wo eher die akademische Avantgarde beheimatet sei, erhalte er weniger Gegenwind. In Jerusalem herrsche dagegen ein anderes Verständnis von Raum und Zeit, die akademische Tradition sei konservativer.
„Der Denker Walter Benjamin wäre zu radikal für das Institut gewesen“, sagt Shahar schmunzelnd. Aber die Gründer selbst, wie Gershom Sholem und Martin Buber hätten die Weichen gestellt für eine liberale Weltanschauung, die in der israelischen Öffentlichkeit bis heute sehr wichtig sei, auch was die Beziehungen zu Palästinenser*innen angehe. Alle hätten die Vision gehabt, dass Palästinenser*innen und Jüdinnen und Juden in einem Staat zusammenleben. Bis heute stehe das Institut für eine demokratische, offene Gesellschaft mit traditionellen Werten.
In erster Linie widmet es sich der Forschung, mit einem großen Archiv alter Zeitschriften und Briefen von jüdischen Emigranten, sowie einer stets offenen Bibliothek mit Büchern deutsch-jüdischer Autoren. Außerdem tagen mehrere Forschungsgruppen von Doktorand*innen, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen: jüdische Sprache, deutsch-jüdische Erziehungstradition, Juden und Natur oder mündliche Geschichte. Jedes Jahr gibt es Ringvorlesungen und internationale Konferenzen zu unterschiedlichen Themen. Außerdem entstehen Publikationen, etwa über Homosexualität und „Gender Studies“ in deutsch-jüdischer Geschichte, oder über die Rolle deutsch-jüdischer Frauen während der Aufklärung wie Rahel Varnhagen oder Fanny Mendelssohn.
Zusammen mit dem Goethe-Institut und dem Rosenzweig-Zentrum gehört das LBI in Jerusalem zu den Orten des Austauschs über deutsche Kultur. Shahar wünscht sich aber, noch mehr jüngere Leute anzuziehen, bislang kämen vor allem die „Jeckes“, die zweite oder dritte Generation der deutschen Juden in Israel. „Wir sollten mehr Veranstaltungen in unserem schönen Garten machen“, sagt Shahar. Zusammensitzen und Lesen, Musik hören, das sei Teil seines Zukunftsplans für das Institut.
Bevor er dessen Präsident wurde, war der Literaturwissenschaftler einige Jahre Mitglied des Beirats, hielt jährlich Vorträge über deutsch-jüdische Literatur, etwa von Stefan Zweig oder Franz Kafka. Von der Ernennung sei er überrascht gewesen, schließlich ist er kein Historiker, sondern Germanist.
Welchen Beitrag kann denn Literatur zum Aufrechterhalten der deutsch-jüdischen Geschichte leisten? „Gute Frage“, sagt Shahar. Die Dichterin Else Lasker-Schüler zum Beispiel habe mehrere Texte geschrieben, in denen sie sich als Prinz Jussuf verkleidet. Sie interpretiere in ihren Texten nicht allein die jüdische, sondern auch muslimische Tradition. „Unsere Aufgabe ist es, die Geschichte immer wieder zu lesen, die politische und kulturelle Vergangenheit neu zu interpretieren.“
Wenn es zum Beispiel um „queer studies“ gehe, also die Erforschung sexueller Identitäten, zeige sich, dass deutsch-jüdische Denker mit Bezug zur rabbinischen Tradition über erotische Männerfreundschaften geschrieben hätten. „Das ist für die Gegenwart interessant“. Auch in Bezug auf den palästinensisch-israelischen Konflikt brauche die israelische Öffentlichkeit Stimmen wie die von Leo Baeck, die Jüdinnen und Juden und Palästinenser*innen selbstverständlich in einem Land zusammen sehen. „Ich sehe keine Zukunft für die israelische Geisteswissenschaft und Kultur, keine Zukunft für Israel als Staat ohne die Veränderung der Beziehungen mit den Palästinensern“, sagt Shahar. Die derzeitigen kulturellen und politischen Lösungen seien zu dünn und gewaltsam.
Die deutsche Sprache und Kultur könne eine gute Vermittlerin sein. Sie biete keine Lösungen, baue aber über ihre besondere Geschichte und heutige demokratische Rolle Räume zum freien Denken auf. Wenn das Jerusalemer Institut so ein Ort ist; wenn Musik aus seinem Garten dringt und alle dort zusammen sitzen und diskutieren, dann ist Shahars Plan aufgegangen, dass Schrift und Leben zusammen gehören.